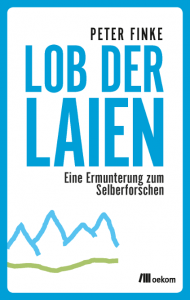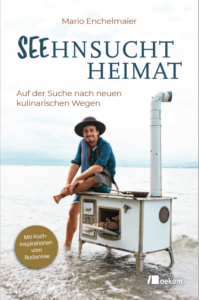
Seehnsucht Heimat
Dieses Buch beschreibt den Weg des Kochs Mario Enchelmaier vom kulinarischen Überfluss zum ursprünglichen Kochen. Mit seinem Feuerherd macht er sich auf zu lokalen Lebensmitteln und Erzeuger*innen, die er mit vielen Kochinspirationen im Buch vorstellt.



 Vielfalt statt Einfalt – diesen Anspruch verfolgt Florian Hurtig in Theorie und Praxis. Er ist Baumpfleger, Permakulturdesigner, Hobbysoziologe und -historiker sowie Klimaaktivist. Aus seiner Beschäftigung mit baumbasierten Polykultursystemen entwickelte er eine Theorie der Differenz des sozialen Netzes, das um Monokulturen oder Polykultursystemen gestrickt ist. Selbst bewirtschaftet er eine baumbasierte Polykultur – die Hundertkultur –, eine Fläche von eineinhalb Hektar, auf der einhundert verschiedene Kulturen wachsen werden. Zusammen mit Freunden gründete er ein Kollektiv, mit dem er eine mobile Obstsaftpresse betreibt und Obstbaumschnitt anbietet.
Vielfalt statt Einfalt – diesen Anspruch verfolgt Florian Hurtig in Theorie und Praxis. Er ist Baumpfleger, Permakulturdesigner, Hobbysoziologe und -historiker sowie Klimaaktivist. Aus seiner Beschäftigung mit baumbasierten Polykultursystemen entwickelte er eine Theorie der Differenz des sozialen Netzes, das um Monokulturen oder Polykultursystemen gestrickt ist. Selbst bewirtschaftet er eine baumbasierte Polykultur – die Hundertkultur –, eine Fläche von eineinhalb Hektar, auf der einhundert verschiedene Kulturen wachsen werden. Zusammen mit Freunden gründete er ein Kollektiv, mit dem er eine mobile Obstsaftpresse betreibt und Obstbaumschnitt anbietet.